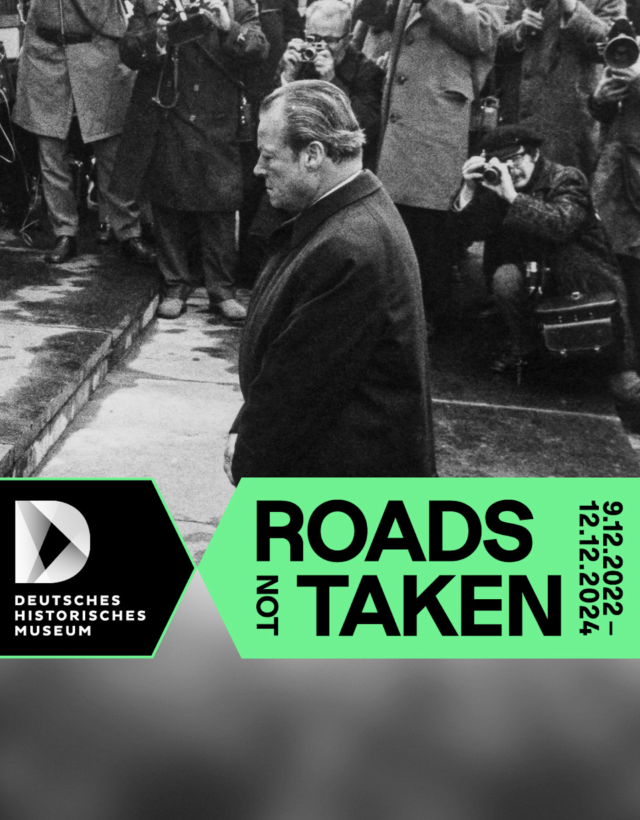Berlin, 30.03.2021 – Digital gestreuter Hass, Antisemitismus, Verschwörungsideologien und Desinformationen verbleiben nicht im Virtuellen, sondern haben reale Konsequenzen. Hier setzt die gemeinnützige Organisation CeMAS mit einem deutschlandweit einmaligen Ansatz an. Team und Technologie werden von der Alfred Landecker Foundation mit exklusiver Gründungsförderung unterstützt.
Die Gefahr verschwörungsideologischer Dynamiken im digitalen Raum wird oft erst dann erkannt und adressiert, wenn sie sich offline manifestiert. Das haben die rechtsextremen und antisemitischen Anschläge, zahlreiche Angriffe auf Journalisten und Politiker, der Angriff auf das Kapitol in Washington, bei dem fünf Menschen starben, sowie der versuchte Sturm auf den Berliner Reichstagsgebäude gezeigt. Das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) wirkt dieser Entwicklung entgegen, indem es Trends und Bewegungen frühzeitig erkennbar macht, sie analysiert und entsprechende Gegenstrategien und Handlungsempfehlungen für Zivilgesellschaft, Politik und Sicherheitsbehörden ableitet und Medien Informationen zur Verfügung stellt. Mit praktischem Fokus auf die Netzwerke Telegram und YouTube untersucht CeMAS dafür Dynamiken und Zusammenhänge von Verschwörungsideologien.
Einmalige Kombination aus Expertise und Methodik
Unter der Leitung der beiden Geschäftsführer Pia Lamberty (Sozial- und Rechtspsychologin) und Josef Holnburger (Politikwissenschaftler) bringt das Team fortschrittliche Monitoring-Methoden und die multidisziplinären Perspektiven langjähriger Experten zusammen. Neben Lamberty und Holnburger vereinen Miro Dittrich, Jan Rathje und Rocío Rocha Dietz Erfahrung und Wissen in den Bereichen Neue Medien und Psychologie sowie Politik- und Kognitionswissenschaften. Der in Deutschland bislang einmalige Ansatz erlaubt es CeMAS, Kommunikation in digitalen Räumen wie Telegram systematisch zu analysieren und einzuordnen. Eigene innovative Studiendesigns, regelmäßige Berichte und detaillierte Auswertungen ermöglichen es außerdem, Phänomene wie den Glauben an Verschwörungserzählungen insgesamt besser zu verstehen.
Dringend notwendige Impulse an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft
Ein wesentliches Augenmerk der gemeinnützigen Organisation liegt dabei auf der Untersuchung der Online-Offline-Dynamiken von verschwörungsideologischen Netzwerken, gerade unter dem Eindruck des Diskurses zur Corona-Pandemie.
Pia Lamberty, Geschäftsführerin CeMAS: „Unsere Arbeit erfolgt dezidiert an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Spätestens die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Perspektiven zusammenzudenken.“
Josef Holnburger, Geschäftsführer CeMAS, ergänzt: „Zukünftige Krisen und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen wie die Bekämpfung des Klimawandels oder ökonomische Krisen können ähnliche Effekte nach sich ziehen, wie wir sie während der Pandemie beobachtet haben. Es ist wichtig, sich nicht nur reaktiv zu Phänomenen wie Verschwörungsideologien und Antisemitismus zu verhalten.“
Alfred Landecker Foundation fördert als gemeinnütziger Inkubator
Die Alfred Landecker Foundation unterstützt CeMAS in den kommenden drei Jahren mit einem Volumen von 2,8 Millionen Euro. Das gemeinsame Landecker re|con Project bündelt dabei die gemeinnützigen CeMAS-Aktivitäten.